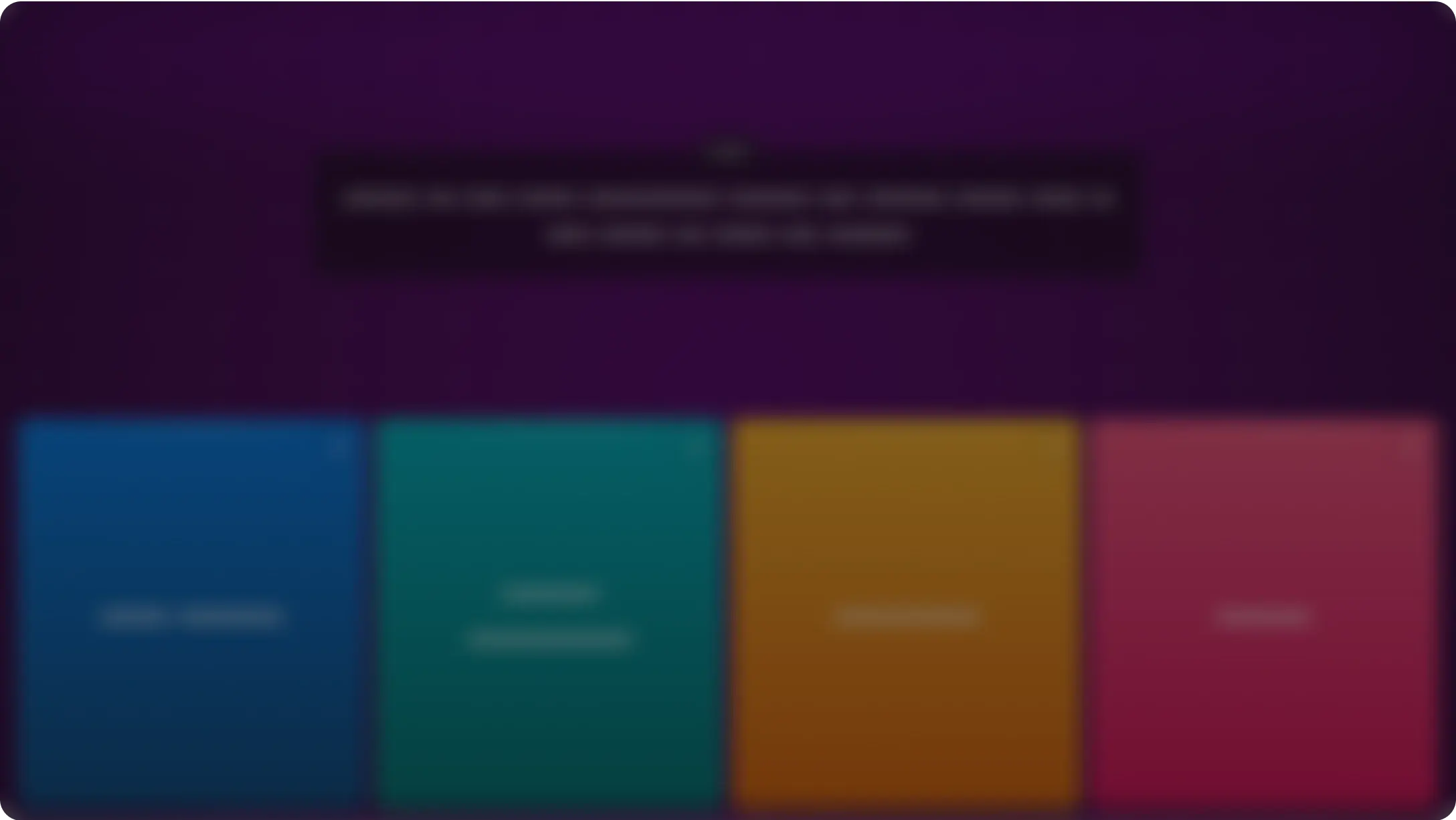Jugendsprache
Quiz
•
Fun
•
University
•
Hard
h4fm94gvp9 apple_user
Used 3+ times
FREE Resource
11 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Das geringschätzige Wort »Tussi« für eine oberflächliche, auffällig gestylte Frau setzte sich in der Jugendsprache der Siebzigerjahre durch, als Endungen auf -i gerade boomten - wie beim Studi, der Mollis auf Chauvis wirft, wenn sie seine Flugis nicht haben wollten. Doch die Wurzeln der »Tussi« gehen viel weiter zurück, wir verdanken sie...
...dem deutschen Schriftsteller Heinrich von Kleist, der 1821 in seinem Drama »Die
Hermannsschlacht« die Figur der
»Thusnelda« als Ehefrau des germanischen
Heerführers Hermann einführte.
..der biblischen Figur des Methusalem, der im Alten Testament als Großvater Noahs auftaucht und das beachtliche Alter von 969 Jahren erreicht haben soll. In den Siebzigern wurde daraus die ironisierte Bezeichnung einer Frau, die ihr Alter durch Make-up zu kaschieren versucht.
...dem französischen Verb »tousser« für
»husten«. In den Zwanzigerjahren begannen französische Jugendliche, einander durch spöttisches Hüsteln auf besonders aufgetakelte Passantinnen aufmerksam zu machen.
Answer explanation
Kleist gilt als Vater der »Tussi« - auch wenn sie bei ihm noch nicht so hieß. Viele Schülergenerationen mussten seine »Hermannsschlacht« lesen, die Nazis instrumentalisierten das Stück zur Glorifizierung germanischen Heldentums. Nachdem »Thusnelda« ab den Fünfzigerjahren als ironische Bezeichnung für affektierte Frauen verwendet wurde, war der Weg frei für die »Tussi« der Siebzigerjahre.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
In den Achtzigerjahren war vieles »geil«, in den Neunzigern »krass«. Alles war krass, von krassen Sprüchen krasser Typen über krasse Musik bis zu den krassen Outfits derer, die dazu abkrassten. Krasserweise aber war der Begriff ursprünglich...
..eine abwertende Bezeichnung einfacher
Bürger zur Zeit der französischen Revolution:
Oft beschimpften französische Adelige weniger betuchte Menschen als »la crasse«
(deutsch: »der Dreck«).
... eine höhnische Bezeichnung aus dem englischen Ganovenslang des späten 19.
Jahrhunderts für das Tun einer Person, die jemanden an die Polizei verpfiffen hat - nach dem englischen Verb »to grass on somebody«,
..eine Schmähung aus der deutschen
Studentensprache. Dort verwendete man das damals noch »crass« geschriebene Wort schon im 18. Jahrhundert - für Erstsemester, die noch keine Ahnung vom Studentenleben hatten.
Answer explanation
Mit »c« schrieb man »crass«, weil es vom lateinischen »crassus« abgeleitet war – was so viel wie »dick, grob, plump« bedeutet. Später wurde daraus zunächst ein negatives Steigerungswort für Begriffe wie »krasser Luxus«. Die positive Bedeutung entstand wohl in der Technoszene der 1990er-Jahre, für einen besonders »harten« Stil.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Wenn jemand in »Schwulitäten« kommt, steckt er in der Klemme und hat Peinlichkeiten zu erwarten. Ist das Wort ebenso homophob gemeint wie das heute in der Jugendsprache häufig abwertend gebrauchte »schwul«?
Ja, Studenten entwickelten den Begriff ursprünglich im 18. Jahrhundert als Bezeichnung für Repressalien, die vermeintliche Homosexuelle beim Eintritt in schlagende Studentenverbindungen zu erwarten hatten.
Nein, tatsächlich ist das Wort verwandt mit
»schwül« und bezeichnet ein Ereignis, bei dem jemand vor lauter Scham ins Schwitzen kommt.
Nein, das Wort bezeichnete die Folgen eines gebrochenen Schwurs - Studenten bildeten es im 18. Jahrhundert durch Anfügung der damals geläufigen ironisierenden Endung »-itäten«, Die Lautverschiebung vom »r« der
»Schwuritäten« zum »l« ergab sich durch einen hessischen Dialekt mit eigentümlich
gerolltem »r«.
Answer explanation
Ursprünglich bezeichnete das niederdeutsche »schwul« die Bedeutung »drückend heiß«. Im Hochdeutschen verwandelte es sich im 18. Jahrhundert erst in »schwül« – die »Schwulitäten« sind also im Grunde »Schwülitäten«, bei denen einem vor Peinlichkeit heiß wird. Erst im 19. Jahrhundert verbreitete sich »schwul« im Straßenjargon als Bezeichnung für sogenannte »warme Brüder«.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Wofür stand im Jugendjargon der DDR in den frühen Achtzigerjahre das inzwischen seltene Wort »urst«?
krass
lame
isso
Answer explanation
Das im Leipziger Duden zum ersten Mal 1983 genannte Wort stand als verstärkendes Adjektiv für äußerste Vollendung. Im West-Duden wurde es nach der Wiedervereinigung erstmals 1991 aufgeführt – mit der Bedeutung »großartig, sehr schön«.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Welchem deutschen Dichter verdanken wir das dem Jugendjargon entlehnte Wort »Pech« im Sinne von »Unglück«?
Johann Wolfgang von Goethe, der es 1788 auf seiner Italienreise unter typisch studentischen Ausdrucksweisen notierte und später beliebt machte.
Bertolt Brecht natürlich. Er verwendete es in seinem Frühwerk »Die Bibel« von 1914, um dem Unglück die beiläufige Bedeutung des Pechs und Schwefels der Hölle beizufügen.
Dem für seine Neologismen bekannten Offenbacher Sprachgesangskünstler
Haftbefehl, der es 2010 auf seinem Debütwerk »Azzlack Stereotyp« nahm, um einen Stabreim mit »Pumpgun« und
»Porsche« zu bilden.
Answer explanation
»Pech« im heutigen Sinn von »Unglück« stammte ursprünglich aus der Sprache von Studenten. Goethe griff es auf – und schrieb zur Steigerung auch häufig von »Saupech«.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Woher stammt eigentlich der Begriff »Randale«?
Udo Lindenberg führte die sozialkritische Wortneuschöpfung 1975 auf seinem Album
»Votan Wahnwitz« ein - als Bezeichnung für Vandalismus, der vom Rand der Gesellschaft ausgeht.
Randalierende Studenten leiteten es im frühen 19. Jahrhundert aus regionalen deutschen Dialekten ab, um ihre überall in Deutschland aufbrandenden Tumulte zu bezeichnen.
Der Begriff stammt aus dem Afrikaans und stand in Südafrika Anfang des 20.
Jahrhunderts ursprünglich für jede Art von Verbrechen, bei denen Geld - in der südafrikanischen Währung »Rand« - erbeutet wurde. Im Zuge der Unruhen gegen das Apartheidregime erweiterte sich die Bedeutung später.
Answer explanation
Studenten waren ab Mitte des 18. Jahrhunderts in vielen deutschen Städten berüchtigt für Trinkgelage, Duelle und Gewalttaten. Das Wort »Randale« schufen sie aus »Rand«, das in der schlesischen Mundart »Menschenauflauf« und im Bayerischen und Österreichischen »Streich« bedeuten konnte.
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
»Hospiz« steht heute für eine Einrichtung zur Betreuung Sterbender. Im Jugendjargon von vor gut 200 Jahren verstand man darunter jedoch noch...
...ein Gasthaus
...ein Eigenheim
...eine Party
Answer explanation
»Hospiz« stand im 18. Jahrhundert für eine rauschende Feier junger Menschen, bei der getrunken, geraucht und getanzt wurde. Allerdings »die Hospiz«, während das heutige Haus der Sterbebegleitung »das Hospiz« heißt.
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground

8 questions
Relativpronomen
Quiz
•
10th Grade - Professi...

10 questions
Artikel
Quiz
•
KG - University

10 questions
Stress
Quiz
•
University

15 questions
Pub Quiz 2023
Quiz
•
University

10 questions
Fragen Suchtprävention
Quiz
•
9th Grade - University

13 questions
Geschichte
Quiz
•
KG - Professional Dev...

10 questions
Cricket
Quiz
•
7th Grade - University

11 questions
Wie gut kennen Sie Kanada?
Quiz
•
University
Popular Resources on Wayground

10 questions
Video Games
Quiz
•
6th - 12th Grade

10 questions
Lab Safety Procedures and Guidelines
Interactive video
•
6th - 10th Grade

25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade

10 questions
UPDATED FOREST Kindness 9-22
Lesson
•
9th - 12th Grade

22 questions
Adding Integers
Quiz
•
6th Grade

15 questions
Subtracting Integers
Quiz
•
7th Grade

20 questions
US Constitution Quiz
Quiz
•
11th Grade

10 questions
Exploring Digital Citizenship Essentials
Interactive video
•
6th - 10th Grade